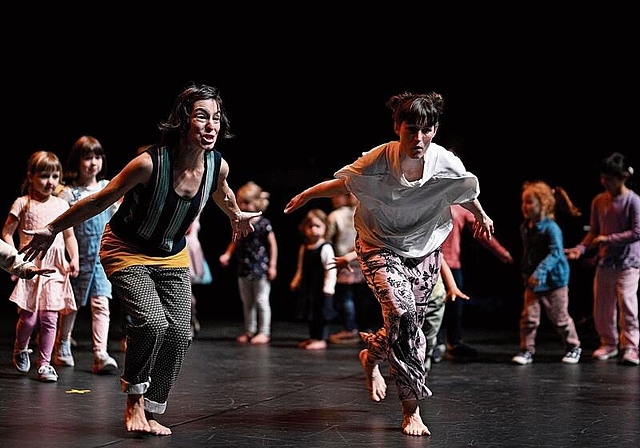Licht ins aktuelle Schulsystem
Schullandschaft Mit dem Schuljahr 2011/2012 trat im Kanton Solothurn die Sek-I-Reform in Kraft. Obwohl vor zwei Jahren eingeführt, sind immer noch Unklarheiten vorhanden. Dieser Artikel soll einen Überblick über die Ziele des neuen Systems und die Veränderungen verschaffen.
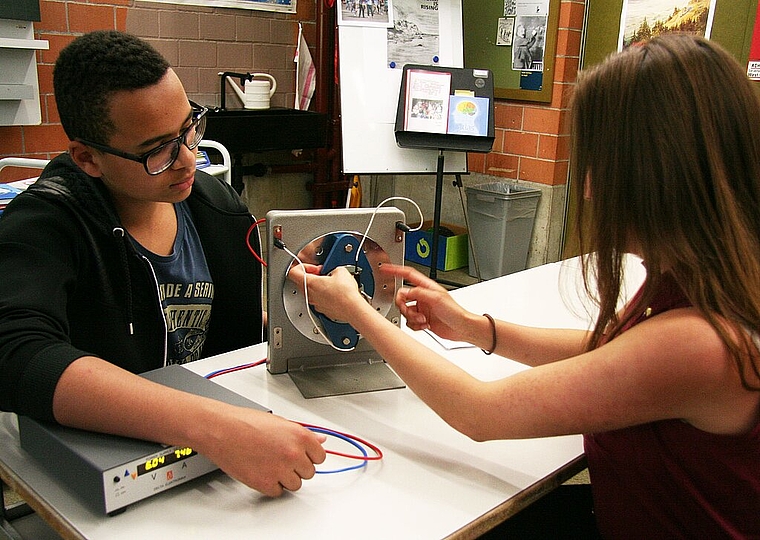
Mit der Sek-I-Reform im Kanton Solothurn wurden die alten Bezeichnungen Untergymnasium, Bezirksschule, Sekundarschule, Oberschule und Werkklasse abgeschafft. Neu gibt es die Stufen Sek P, Sek E und Sek B. Dies ist jedoch nur eine der zahlreichen Veränderungen.
Neue Verteilung der Stufen
Die Sek-I-Reform ist die Antwort auf verschiedene Probleme, die sich auf der Sekundarstufe I schon seit längerem abgezeichnet haben. Eines davon war die Aufteilung der Oberstufe auf fünf Niveaus. Deshalb wurden diese im Zuge der Reform auf drei Stufen reduziert. Die Abkürzungen stehen für die Anforderungen und für die Ziele der Stufen: Die Sek B (Basisanforderungen) führt in eine Berufslehre, die Sek E (Erweiterte Anforderungen) in eine Berufslehre mit Berufsmaturität oder an die Fachmittelschule (FMS). Die zweijährige Sek P (Progymnasium) ersetzt das frühere Untergymnasium und bereitet auf die Matura an den Kantonsschulen Olten oder Solothurn vor. Im Unterschied zu vorher ist aber der Übertritt in die Oberstufe harmonisiert. Die Möglichkeit, nach der 5. Klasse ins Untergymnasium zu wechseln, gibt es nicht mehr. Der Übertritt erfolgt für alle nach der 6. Klasse und nach einem einheitlichen Verfahren. Berücksichtigt werden dabei die Zeugnisnoten aus dem 2. Semester der 5. Klasse und dem 1. Semester aus der 6. Klasse sowie die Ergebnisse einer kantonsübergreifenden Vergleichsarbeit. Die frühere Werkklasse für Schülerinnen und Schüler mit grossen schulischen Schwierigkeiten wurde parallel zur Sek-I-Reform in die Sek B integriert. Die Einteilung in die drei Stufen liegt bei den folgenden Richtwerten: 15 bis 20 Prozent der Schüler treten in die Sek P, 40 bis 50 Prozent in die Sek E und 30 bis 40 Prozent in die Sek B ein.
Ziele der Reform
Die Vereinheitlichung des Übertritts und die Reduktion der Stufen waren zwei Ziele der Reform. Ein weiteres war die Verbesserung der Durchlässigkeit innerhalb der Stufen. Mit genügend hohem Notenschnitt ist es möglich, unter Verlust eines Jahres eine Stufe aufzusteigen. Es ist aber auch möglich, auf eine tiefere Stufe zu wechseln. Eine Anpassung der Lehrpläne soll ausserdem die Vorbereitung auf die Berufslehre verbessern. Auf den Stufen B und E wird pro Woche eine Lektion des Fachs «Berufsorientierung und Kommunikation» unterrichtet. Durch die wöchentliche Auseinandersetzung mit der Berufswahl soll es den Schülerinnen und Schülern leichter fallen, schulisch am Ball zu bleiben. Zusätzlich sind pro Jahr zwei Praktikumswochen eingeplant. Dort gibt es die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler Ateliers zu berufsrelevanten Themen besuchen oder ein Praktikum in einer Firma absolvieren. Wie schon im alten System wird in der Sek P kaum Berufsvorbereitung vermittelt. Stattdessen gewährleistet der Sek P-Lehrplan eine einheitlichere Vorbereitung auf die Maturitätsschule. Vor der Reform traten Schülerinnen und Schüler aus der Bezirksschule und aus dem Untergymnasium in die Maturitätsschule ein. Heute führt der Weg ins Gymnasium ausschliesslich über die Sek P.
Änderungen innerhalb der Stufen
Mit der Sek-I-Reform wird die Sek P ein Stück weit von der Kantonsschule an Sekundarschulstandorte geholt. Anstelle von 27 Bezirksschulstandorten und zwei gymnasialen Zügen an den Kantonsschulen gibt es heute neun Sek P-Standorte, einschliesslich der Kantonsschulen. Das Fach Latein ist nicht mehr obligatorisch. Neu wählen die Schüler zwischen den zwei Wahlpflichtfächern Latein sowie Wissenschaft und Technik. Da die Sek P ein Jahr kürzer ist als das Untergymnasium, wurde der Lehrplan auch in anderen Fächern angepasst. Trotzdem bleibt das Ziel im Fokus, das frühere Niveau möglichst zu erhalten, damit die Schülerinnen und Schüler gut auf die gymnasiale Matura vorbereitet sind. In der Sek E und B stellt man ausserdem angepasste Zeugnisse aus. Zusätzlich zu den Noten enthalten die Zeugnisse auch Beurteilungen über Lernverhalten und Soziales. Dadurch ist eine differenzierte Einschätzung des Schülers möglich.
Zukunftsaussichten
Viele Fragen sind aktuell noch offen. Bezüglich der Sek P ist fraglich, ob die Vorbereitung auf das Gymnasium mit zwei statt drei Jahren gleich gut gelingt. Auf der Sek E-Stufe und vor allem auf der Sek B-Stufe hat sich die Heterogenität bezüglich der Leistung der Klasse stark erhöht. Besonders seit der laufenden Integration der Werkklasse sind die Lehrer der Sek B gefordert. Allgemein lassen sich erst zurückhaltende Aussagen treffen. Um das neue System mit dem alten aussagekräftig vergleichen zu können, müssen noch einige Jahrgänge abgewartet werden.