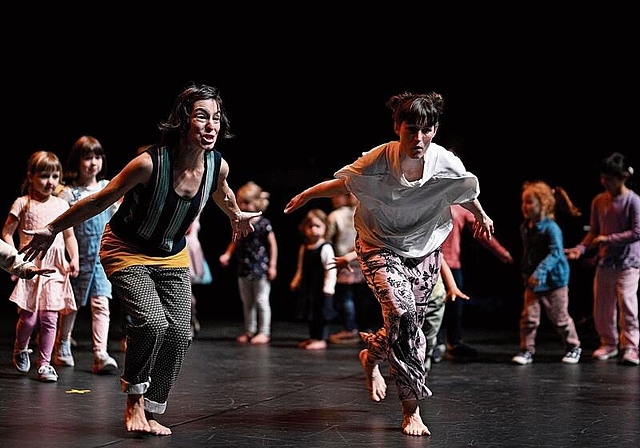Wie kamen die Eier zum Osterfest?
Osterbräuche Entgegen der ursprünglichen Bedeutung werden mit dem Osterfest heute Eier, Hasen oder Schokolade verbunden. Warum diese Volksbräuche nicht dem christlichen Gedanken widersprechen und woher diese kommen, ergründeten wir mit Diakon Andreas Brun.
Beim Gedanken an das Osterfest kommen heute wohl den meisten «Eiertütschen», feine Schoggi- hasen oder eventuell ein gemütlicher Brunch mit der Familie in den Sinn. Kein Wunder - schliess- lich sind es genau diese Volksbräuche oder Lebensmittel die medial und kommerziell mit dem christlichen Fest in Verbindung gebracht werden.
Das Fest vom Leben
Obwohl diese Assoziationen auf den ersten Blick nur wenig mit dem Ursprung von Ostern, sprich der Auferstehungsgeschichte von Jesus Christus, zu tun haben, steht die Kirche ihnen heutzutage offen gegenüber. So wird auch im römisch-katholischen Pastoralraum Olten gemeinsam Eier gefärbt oder an der Osternacht «getütscht». «Solche Bräuche sind Teil des gemeinschaftlichen Lebens und haben etwas Verbindendes. Genau diese Komponente passt zu Ostern: Schliesslich ist es auch ein Fest des Lebens», erklärt der Oltner Pastoralraumleiter und Diakon Andreas Brun. Zudem stehe das Ei auch als Zeichen für Auferstehung. Das Küken «sprenge» die Eierschale und erwache so zum Leben. «Auch Hasen kommen bereits in alten Kirchenbildern als Symbol für Fruchtbarkeit vor», so Andreas Brun.
«Blutige» Eier im 11. Jahrhundert
Laut Prof. Manfred Becker-Huberti von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar, ein Experte für religiöse Volkskunde, wurden in der katholischen Kirche bereits 1054 hart gekochte, rot angemalte Eier an die Besucher der Osternacht verteilt. Die Farbe stand dabei für das Blut Jesus. Eier verschiedenfarbig anzumalen kam erst später dazu. Des Weiteren ist das Ei seit je ein Zeichen des keimenden Lebens und passt damit thematisch zu Ostern. Der Name Osterei könnte jedoch einen weniger erfreulichen Ursprung haben. Wie «Du», eine renommierte Kulturzeitschrift aus Zürich, bereits im Jahr 1942 berichtete, mussten unfreie Bauern ihren weltlichen und kirchlichen Herren immer um die Osterzeit sogenannte Zinseier abgeben. Generell muss im Mittelalter nach der 40-tägigen Fastenzeit ein Eierüberschuss geherrscht haben. Denn wie Fleisch fielen Eier unter das Abstinenzgebot und durften erstmals wieder am Ostersonntag verspeist werden.
Mit «Tütschen» den Segen bringen
Das «Eiertütschen» könnte mit dem Glauben zusammenhängen, dass erst in ein aufgeschlagenes Ei, der Segen eindringen kann. «In Kroatien ist es Brauch, die Eier und sonstige Osterspeisen zur Segnung in die Kirche zu bringen. So entwickelt jede Kultur seine Riten», weiss Brun. Der Hase als Gabenbringer taucht laut Becker-Huberti vermehrt ab dem 17. Jahrhundert auf. Sein Ursprung ist nicht ganz klar. Er war zwar das Symbol der germanischen Fruchtbarkeitsgöttin Eostre, dessen Fest im Frühling gefeiert wurde und deshalb zum Osterbrauch passt. Doch wirklich populär wurde der Hase erst 200 Jahre später - im Schokoladenmantel.
Kreuzweg für Kinder
Obwohl Ostern in der christlichen Tradition einen ebenso, wenn nicht noch höheren Stellenwert hat als Weihnachten, wird das Fest in Schweizer Familien oftmals weniger intensiv zelebriert. Auch der Ursprung dahinter ist nicht ganz so geläufig. «Mit den vielen wärmenden Lichtern und den grossen Familienessen hat Weihnachten einen anderen Stellenwert als das frühlingshafte Ostern», erklärt sich Brun den Unterschied. Zudem sei der thematische Inhalt von Weihnachten viel zugänglicher. «Jedes Kind hat bereits von der Geburt oder dem Start eines Lebens gehört. Tod und vor allem Auferstehung sind schwierigere Themen und werden im Alltag seltener angesprochen», so Brun. Um den Zugang zur Geschichte vom Karfreitag und auch Ostern zu erleichtern, führt der römisch-katholische Pastoralraum Olten am Karfreitag, 30. März einen Kreuzweg für Kinder und Familien durch. «Zu Fuss erleben wir dabei die unterschiedlichen Stationen von Jesus.»
Eindrückliche Anbetungsnacht
Nebst der traditionellen Osternacht mit «Eiertütschen» und grossem Feuer am Samstag wartet mit der heutigen Anbetungsnacht der franziskanischen Gemeinschaft ein noch spezieller Anlass in der Kirche St. Marien. «Gläubige jeden Alters und aus unterschiedlichsten Kulturkreisen bleiben dabei wach und führen von heute Abend bis 5 Uhr morgens jede Stunde Gebetshalte durch. Ein eindrückliches Erlebnis», schwärmt der Diakon. Anschliessend werde am frühen Morgen der Kreuzweg zur St. Martinskirche durch die langsam aufwachende Stadt angetreten. Nebst den vielfältigen Gottesdiensten schätzt Andreas Brun an Ostern aber auch vor allem etwas: Zeit mit der Familie zu verbringen. Damit ist er wohl nicht alleine.
<link http: www.katholten.ch>www.katholten.ch